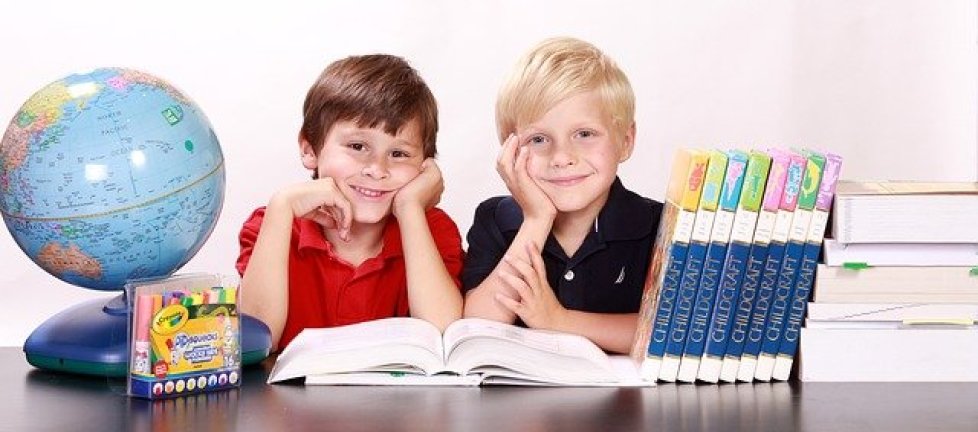Entgegen der allgemeinen Meinung erweist sich die Rechenstörung mit einer Prävalenz von unge fähr 4 – 6 % im deutschprachigen Raum als ähnlich weit verbreitet wie die wesentlich besser be kannte Lese- und Rechtschreibstörung. Eigentlich kann dies kaum verwundern, stellen doch beide Störungen sogenannte umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (UESF) dar. Das bedeutet, dass von Beginn an die Entwicklung des Kindes in bestimmten Bereichen nachteilig von der Entwicklung normalgesunder Kinder abweicht. Und dies lässt sich eben nicht auf eine neu rologische Erkrankung oder etwa einen Unfall zurückführen – die Entwicklung ist betroffen. Als be einträchtigt erweisen sich in der Regel die visuell-räumliche Wahrnehmung, Sprechen und Sprache sowie die Bewegungskoordination. So kann es kaum verwundern, dass sich in der Rückschau ent sprechende Hinweise bereits in den U-Heften der Vorsorgeuntersuchungen finden lassen. Eine Be einträchtigung dieser Fähigkeiten zeigt sich dann im weiteren Entwicklungsverlauf insbesondere in einem mangelhaften Erwerb schulischer Fertigkeiten. Bei der Rechenstörung ist hier lediglich das Rechnen in einem auch klinisch bedeutsamen Ausmaß betroffen. Der Störungsbereich ist also genau definiert – eben umschrieben.
Zunächst sollten wir uns klar darüber sein, dass eine Rechenstörung eine Beeinträchtigung in den Grundrechenarten darstellt, der genau definierte diagnostische Kriterien zugrunde liegen. Eine sol che Störung ist also klar abzugrenzen von einer bloßen Rechenschwäche oder von Rechenschwierigkeiten. Diese Begriffe erweisen sich als unscharf und erweisen sich etwa für schulische Entscheidungen zur Gewährung von Nachteilsausgleichen oder Notenschutz als unbedeutend. Eine fundierte und auch von Jugendämtern anerkannte Diagnostik (zur Kostenübernahme s. § 35a SGB VIII) muss klaren Ansprüchen genügen, wie sie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10; → dimdi.de) oder auch in den Leitlinien zu UESF der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaflichen Medizischen Fachgesellschaf ten (AWMF; → awmf.org) dargestellt sind.
Als grundlegend für die Diagnosestellung erweist sich in jedem Falle eine deutliche Diskrepanz zwischen a) der individuellen Intelligenz und der individu ellen Rechenleistung einserseits sowie b) dem individuellen Abschneiden in einem standardisierten Rechentest im Vergleich zum allgemeinen Abschneiden anderer Schülern desselben Alters bezie hungsweise derselben Klassenstufe (Bezugsnorm). Man spricht hier vom sogenannten Doppelten Diskrepanzkriterium.
Die Unterschiede zwischen ICD-10 und AWMF-Leitlinien liegen in der genauen Bestimmung die ser für eine Diagnosestellung zwingend erforderlichen Diskrepanze; eine Diagnosestellung ohne die Durchführung eines Intelligenztests ist unzulässig. Das Multiaxiale Klassifikati onsschema (MAS) nach ICD-10 formuliert in seinen diagnostischen Leitlinien (Forschungskriteri en) eine Diskrepanz zwischen Intelligenzquotient und Rechenleistung von mindestens zwei Stan dardabweichungen1. Dabei sollte die Rechenleistung deutlich unter der Leistung der entsprechenden Bezugsgruppe liegen (< 3 %). In den klinischen Empfehlungen der AWMF-Leitlinien hingegen be trägt die Diskrepanz zwischen Intelligenzleitung und daraufhin zu erwartender Rechenleistung le diglich 1.2 Standardabweichungen (zwischen 1 und 1.5), und die Rechenleistung sollte einen Pro zentrang von 11 unterschreiten (≤10). Hiermit lassen sich folglich wesentlich mehr Diagnosen stellen. Aus klinischer Sicht sollte das Patientenwohl im Vordergrund stehen, und eine gewissenhaf te Diagnose sollte sich an den verschiedenen zur Verfügung stehenden Kriterien ausrichten.
Ein deutlicher Nachteil der Diagnosestellung anhand des doppelten Diskrpanzkriteriums be steht darin, dass Schülerinnen und Schüler mit extremen Intelligenzausprägungen diese Kriterien oftmals nicht erfüllen können. Da grundsätzlich ein Zusammenhang zwischen Intelligenniveau und Rechenleistung angenommen wird, ist davon auszugehen, dass Menschen mit sehr hoher Intelligenz nur überaus selten so schlecht im Rechnen sind, dass Sie einen Prozentrang von 11 in einem Rechentest unterschreiten. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass diesen Menschen das Rech nen im persönlichen Vergleich (intraindividuell) sehr schwer fällt, und dass Sie darunter leiden können. Hier sollte der klinisch relevante Leidensdruck zunächst im Vordergrund stehen. Eine Diagnose Rechen störung ist also in solchen Fällen zu rechtfertigen, auch wenn die Rechenleistung im Vergleich mit der Bezugsnorm womöglich nicht einmal unterdurchschnittlich ausfällt. In solchen Fällen kann das sogenannte Regressionsmodell Anwendung finden, das eine Diagnosestellung auch bei extremen Intelligenzausprägungen (sehr hoch oder sehr niedrig) erlaubt. In allen Fällen ist jedoch ein Intelli genzquotient von ≤ 70 als Ausschlusskriterium zu betrachten. Hier ist eine Intelligenzminderung (geistige Behinderung) zu diagnostizieren, sodass die defizitäre Rechenleistung nicht mehr auf eine Entwicklungsstörung sondern auf die allgemeine kognitive Begabung zurückzuführen ist.
Die Diagnostik von Rechenstörungen kann allein anhand einer Überprüfung der Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) erfolgen. Eine Ursachenklärung etwa mit Bezug zur Therapieplanung (Förderdiagnostik) sollte hingen auch basale Fähigkeiten untersuchen, die dem Verständnis und der Anwendung von Rechenprozeduren (Konzept- und Prozeduralwissen) zugrun de liegen. Dies sind etwa visuell basierte Mengen- und Größenvorstellungen, Mengenbilden und Mengenschätzen, der semnatische Gehalt einer Zahl (Kardinal- und Ordinalaspekt), Zählprinzipi en, Stellenwertsystem und vieles mehr.
Die gelungene Zahlbegriffsentwicklung und deren sinnge leitete Anwendung in den verschiedenen Rechenoperationen geht einher mit der Ausbildung eines sogenannten mentalen Zahlenstrahls. Diese Vorstellung eines flexibel strukturierbaren Zahlenraums ermöglicht uns etwa schnelle Überschlagsrechnungen und hilft uns, uns in der Welt der Zahlen zu rechtzufinden. An dieser Stelle wird auch deutlich, welche Rolle die visuell-räumliche Wahrneh mung beim Rechenerwerb spielt. Eine umfassend pädagogisch ausgerichtete Diagnostik sollte dem gemäß auch eine differenzierte Untersuchung der visuellen Informationsverabeitung (räumlich-perzeptiv, räumlich-kognitiv und räumlich-konstruktiv) beinhalten. Hiervon unberührt bleibt natür lich die gleichsam obligate Überprüfung basaler neuropsychologischer Funktionen wie Aufmerk samkeit, Lern- und Merkfähigkeit sowie insbesondere des Arbeitgedächtnisses. Eine Intelligenzdia gnostik mit einem multidimensionalen Verfahren kann hier anhand eines differenzierten Leistungs profils über die verschiedenen Untertests und Subtestindizes hinweg erste wertvolle Informationen liefern. Aus diesem Grunde ist ein solches ausfürliches Verfahren anderen kürzeren Verfahren im mer vorzuziehen.